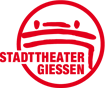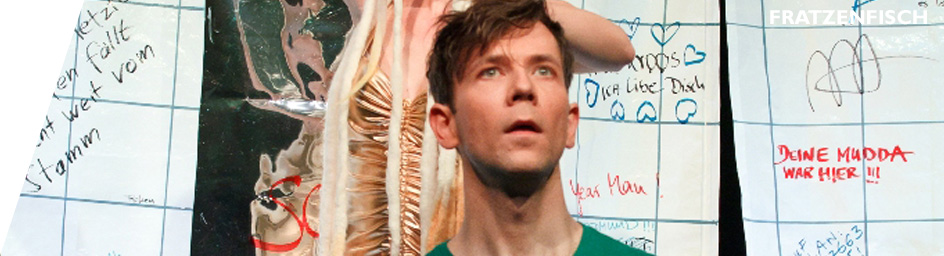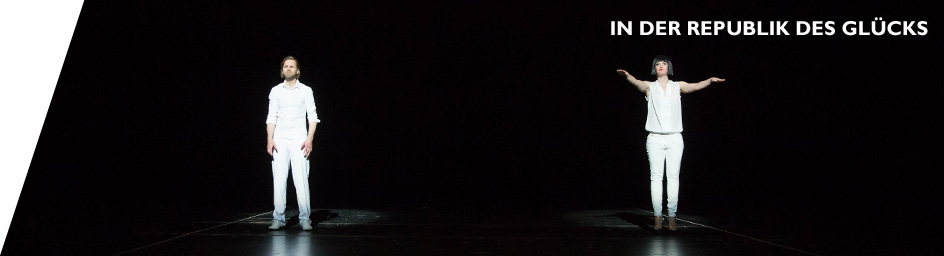Zwischen Revue und Offenbachiade: fulminant pfeffrige Bouffe - Der Opernfreund
Zwischen Revue und Offenbachiade: fulminant pfeffrige Bouffe
Wenn die Autoren Riese und von Flotow ihr Werk Alessandro Stradella „Romantisch-Komische Oper“ nennen, dann wohl weil sie zur Uraufführung 1844 in Hamburg unter diesem Untertitel 1844 am besten verkaufbar erschien. Während aber für „Martha, das erfolgreiche Folgewerk von Flotows, diese Bezeichnung sehr zutreffend ist, wird man beim Stradella fehlgeleitet: hier handelt es sich um eine Opéra comique im französischen Stil (allerdings ohne gesprochene Dialoge) mit Vorgriffen auf den Stil der Bouffe, die erst zwanzig Jahre später von Offenbach zum Kulminationspunkt gebracht wurde. Eine Oper mit hohem Unterhaltungswert: Lokalkolorit, große Chöre, Ballett, Banditen und eine schmissige originelle Musik mit Tänzen und einfachen Formen. Wenn sie dann noch so fulminant auf die Bühne gebracht wird wie von dem Regisseur Roman Hovenbitzer, sind schon die meisten Zutaten für einen gelungenen Opernabend vorhanden.
Die Titelfigur Alessandro Stradella ist einer der erfolgreichsten Komponisten und Musiker des italienischen Seicento und gleichzeitig eine der schillerndsten Figuren der Musikszene überhaupt. Sein Erfolg als Musiker paarte sich mit dem seiner amourösen Eroberungen, was ihn aber in Eifersuchtsdramen verwickelte, in deren Folge er im wirklichen Leben auch einem Mordanschlag zum Opfer fiel. Friedrich Wilhelm Riese schrieb das Libretto nach einer Vorlage eines Vaudevilles gleichen Namens von Pittaud de Forges und P. Dupont. Gewisse Parallelen gibt es zu Berlioz‘ Benvenuto Cellini. Dennoch ist Alessandro Stradella keine Künstleroper, da die Oper nicht den Kampf des Künstlers um seine Kunst thematisiert, sondern die „unerwünschte“ Wechselwirkung des Künstlers und seiner Kunst mit seinem Umfeld.
Die Handlung ist denkbar schnell erzählt: Bassi, ein reicher Venezianer, möchte sein reiches Mündel Leonore ehelichen; aber Stradella ist hinter ihr her, entführt sie im Karnevalstrubel in ein Landhaus nach Rom, wo sie der Kunst und der Liebe leben und heiraten. Bassi schickt gedungene Mörder, die Stradella beseitigen sollen. Diese aber, gerührt von Stradellas Musik und Gesang, führen den Mordplan nicht aus. Bassi reist ihnen nach und erhöht der Mörderlohn auf das Zehnfache. Doch wieder obsiegt die Musik: beim Kirchengang ertönen hold fromme Klänge, der Mordplan wird wieder nicht ausgeführt, die „Rächer“ geben auf: Happy End, Leonore und Alessandro entschweben ins Elysium der Kunst und der Liebe. Das wäre zum Gähnen langweilig, wenn die Regie versucht hätte, eine romantische Künstleroper zu machen. Stattdessen mischt Hovenbitzer das Ganze neu auf, verfremdet vom Trivialen, stellt nichts genauso auf die Bühne, wie es eine konventionelle ZHandlungszusammenfassung wie die obige ahnen lassen würde und schafft mit einer grellbunten Inszenierung ein Feuerwerk von Witz und Ironie. Etliches hat man schon woanders gesehen, aber in der Zusammenstellung wirkt das alles sehr originell. Dabei wird auch vor kleineren Eingriffen in die Partitur nicht zurückgeschreckt. Hovenbitzer kann sich sicherlich die Bezeichnung „Nachwuchsregisseur“ verbitten; aber unter den „jüngeren Opernregisseuren“ muss man ihn als Top-Talent sehen, der ohne zu dekonstruieren die Szene aufzumischen versteht.
Schon bei der inszenierten Ouvertüre wird eine kleine Gesangsnummer des Stradella eingefügt. In der ersten Szene ist gerade eine größere Lieferung von Kartons mit der Aufschrift „Achtung Kunst“ angekommen. Aus einem dieser Colis holt Stradella Leonore haraus, und dann wird erst einmal ein Quickie in diesem Karton veranstaltet. Von Bassi erwischt, wird Leonore in dem Riesenkarton an einem Seil über eine Umlenkrolle an den Bühnenhimmel gehoben. Dort eingesperrt soll sie nun fortan unberührbar auf die Hochzeit mit Bassi warten. (Eigentlich wäre das ein Zimmer mit Balkon – Barbiere lässt grüßen!) Stradella bringt ihr nach dort oben ein Ständchen, sprengt die Verankerung des Festhalteseils mit einer Bombe, deren schmökende Lunte zunächst immer wieder ausgehen will, holt sie also heraus und verabschiedet sich bei einer Barcarole. Hermann Feuchter hat hierzu auf der Drehbühne um die Szene herum mit „locker“ bemalten Wandelementen ein Viereck geschaffen, das im zweiten Akt schon das Ehebett des Paares zeigt, dann umgeben von großflächigen Rubensgemälden mit barocken Frauenfiguren, neben denen Plakate für einen Auftritt von Stradella werben. Der Tisch mit dem Hochzeitsbuffet ist schon vorbereitet. Die gedungenen Mörder erscheinen mit Violinkästen, aus denen sie MPs herausholen. Die Drehbühne verwandelt die Szene in ein kleines Theater, in welchem Stradella für die Hochzeitsgäste eine Arie vorträgt, zu welcher er auch die beiden Ganoven auf die Bühne holt, die da unfreiwillig komisch mittun müssen: die genialste Szene der ganzen Oper. Vier Tänzerinnen der Showtanzgruppe „Soul System“ (aus dem nahe gelegenen Hungen) treten in schneller Folge in wechselnden Kostümen auf und gestalten die Tanzszenen. (Die Choreographie besorgt Tarek Assam, wobei er die Chöre viel besser in Szene setzt als das Tänzerinnenquartett, das mehr wie eine Cheer-Gruppe wirkte.) Die Kostüme von Bernhard Niechotz sind bunt, dem 17. Jahrhundert bizarrisierend nachempfunden und werden durch gelungene Beleuchtungswechsel (Manfred Wende) in ihrer Wirkung teilweise noch vervielfältigt.
Tempo und Witz der Inszenierung vermag die musikalische Darbringung nicht immer zu folgen. Zwischen Graben und Bühnen herrschten hier und da „Meinungsverschiedenheiten“; aber im Großen und Ganzen gelang es Jan Hoffmann, der auch die Chöre einstudiert hatte, die Partitur schwungvoll und inspiriert ‘rüberzubringen. Dabei verdienen Chor und Extrachor ein besonders Lob; denn ihr Gesang und turbulentes Spiel stellen ein tragendes Element der Produktion dar: eine Choroper mit Bewegungschor. Bei den Gesangsleistungen ergab sich indes ein gemischtes Bild. Anna Gütter konnte als Leonore mit wendigem Spiel und beweglichem gut geführtem Sopran für sich einnehmen. Corey Bix präsentierte sich als Stradella mit einem stimmgewaltigen Tenor und Strahlkraft, indes nicht sehr kultiviert, nicht immer sauber und vor allem gegen Ende mit erheblichen Intonationsproblemen. Stephan Bootz gab mit etwas trockenem Bariton solide den Bassi, während Tomi Wendt als Ganove Malvolino mit schön grundiertem Bariton überzeugte. Wojtek Halicki-Alicca sang den Ganoven Barbarino als tenorales Gegenstück und spielte dabei sein komödiantisches Talent ebenso aus wie der Rest der Truppe, die unentwegt in Bewegung war und die Fülle von Regieeinfällen prima umsetzte.
Manfred Langer, 9.2.2012, Opernfreund