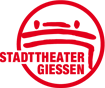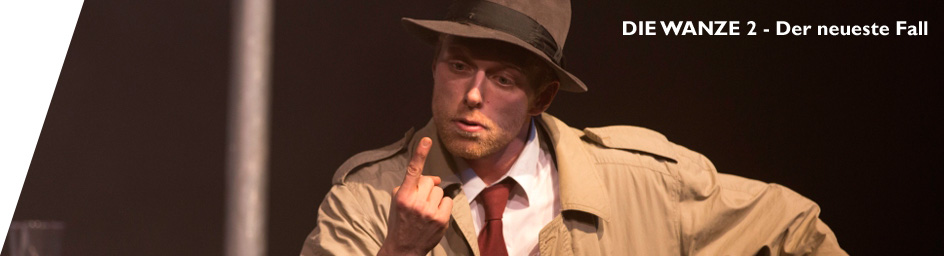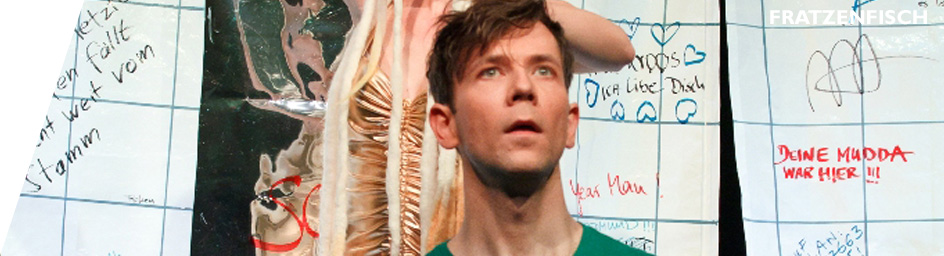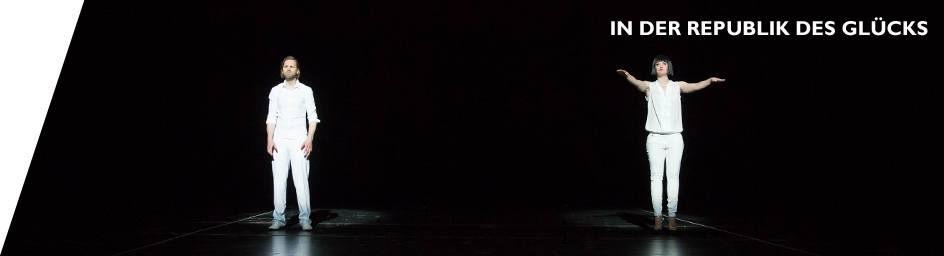DER FREISCHÜTZ - Abgründe der Seele - Der Opernfreund
Der Gedankenwelt eines Sigmund Freud scheint die Neuproduktion von Webers „Freischütz“ am Stadttheater Gießen entsprungen zu sein. Der britische Regisseur Nigel Lowery will von altbackener Schauerromantik im traditionellen deutschen Märchenwald Gott sei Dank nichts wissen. Sein Ansatz ist vielmehr psychoanalytischer Natur. Im letzten Bild offenbart sich, dass die Handlung in einer Nervenheilanstalt angesiedelt ist, der der als Psychiater vorgeführte Eremit als Leiter vorsteht und in die die weiteren, ebenfalls von Lowery entworfenen Spielorte geschickt eingepasst werden, so der Schützenverein des ersten Aufzuges, dem Kuno als eine Art Wildwest-Sheriff vorsteht, und der Waffenladen, der im zweiten Akt an die Stelle des Jagdschlosses tritt. Den Bühnenbildern kommt indes nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Den Regisseur interessiert vielmehr die innere Handlung, das Seelenleben der Handlungsträger, die allesamt als Patienten der Psychiatrie aufzufassen sind. Mit großer Vehemenz dringt Lowery bis in die untersten Schichten der menschlichen Seele vor, deren Auswüchse er in eindringlichen Bildern schonungslos aufzeigt. Dabei hat er die Person des schwarzen Jägers Samiel gestrichen und seinen Text Max überantwortet. Zwei Seelen wohnen also in der Brust des jungen Jägerburschen, eine gute und eine böse, die erbittert um die Vorherrschaft kämpfen. Daher ist es nur konsequent, dass Kaspar als Alter Ego von Max erscheint. Wenn der Bösewicht seinen ersten Auftritt während des letzten großen dramatischen Ausbruches von Max bei dessen Es-Dur-Arie „Durch die Wälder, durch die Auen“ - während des vorangegangenen „O diese Sonne“ wurde sein Part von Kilian übernommen -, aus einem verspiegelten Schrank heraus hat, wird deutlich, dass es sich bei den beiden Kontrahenten um zwei Seiten derselben Medaille handelt.
Im Folgenden werden sie äußerlich von der Kostümbildnerin Bettina Munzer immer mehr aneinander angeglichen. Unter diesen Voraussetzungen ist es fast selbstverständlich, dass auch die Wolfschluchtszene nicht als reales Geschehen zu verstehen ist, sondern als innerer Zustand, als Möglichkeit zur Auslebung vielfältiger gewalttätiger und sexueller Triebe. Erstere erfahren hier einen bis zum Äußersten gesteigerten Exzess, als Max in der Maske eines Terroristen - dasselbe Outfit haben Agathe und das herrlich unkonventionell als ältliche Hausvorsteherin gezeichnete Ännchen zuvor einer männlichen Schaufensterpuppe angelegt - zum Gießen der Freikugeln erscheint und in einer Videoprojektion mit seinem Gewehr die Schülerinnen eines Mädcheninternats gnadenlos niedermetzelt. Der zum Schluss der Szene sichtbar werdende riesige Phallus ist Ausdruck einer bis ins Maßlose hinein gesteigerten sexuellen Obsession, gegenüber der sich die beim Jägerchor auftretende Table-Tänzerin, die die halbnackten Mitglieder des Schützenvereins bereitwillig unterhält, geradezu harmlos ausnimmt. Das ganze Wolfsschluchtsbild ist mithin auch als Spiegelbild der Seele zu verstehen, als Ausdruck nicht ausgelebter Begierden und Triebe, allgemein als Projektionsfläche für alle möglichen menschlichen Abgründe, die in irgendeiner Form nach außen drängen. Sex und Crime regieren die Welt. Das Böse sucht sich als ehernes Prinzip immer neue Erscheinungsformen und etabliert sich auch dort, wo man es am wenigsten erwartet, so bei den zombiehaft und dämonisch anmutenden Brautjungfern, deren Lied vom Jungfernkranz den Charakter eines Totengesanges annimmt. Sie glauben, Agathe fest in ihrer Gewalt zu haben und malen ihr als Sinnbild dafür ein weißes Kreuz auf das Gewand.
Dasselbe Zeichen verpassen sie bald darauf der ganzen Jagdgesellschaft und geben diese wie die Sheriffstochter damit im wahrsten Sinn des Wortes dem Abschuss preis - eine tolle Symbolik, bei der die Ähnlichkeit mit dem Siegfried-Kreuz aus dem Nibelungenlied naheliegend ist. Es liegt bei den Menschen, ob sie sich widerstandslos dem Bösen hingeben und daran zugrunde gehen. Den als eine Art Beckett’sche Abziehfigur von Anfang an immer wieder durch die Szene geisternden alten Schützenkönig Ottokar hat der Kampf bereits nachhaltig in den Wahnsinn getrieben und Max, der zuvor mit Kaspar einen Teil seines eigenen Ichs erschossen hat und darob in Verzweiflung verfällt, endet in der Gummizelle der Nervenheilanstalt. Wider die Vorlage hat der Eremiten-Arzt kein Erbarmen mit ihm - ein sehr pessimistisches Ende, das sich stark an der literarischen Vorlage von Johan August Apel orientiert. Insgesamt haben wir es hier mit einer ungemein spannenden, geistig anspruchsvollen und hoch innovativen Inszenierung zu tun, die Nigel Lowery als versierten modernen Regisseur ausweist. Das war hochkarätiges Musiktheater, wie es sein soll! Dem Theater Gießen kann man dazu nur gratulieren. Solchen Inszenierungen gehört die Zukunft. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass auch an kleinen Opernhäusern hervorragende Produktionen geschaffen werden, die die Rezeptionsgeschichte eindrucksvoll ergänzen.
Am Pult räumte der neue - und alte - GMD Michael Hofstetter mit überkommenen Hörgewohnheiten nachhaltig auf. Wenn man glaubte, Webers Partitur gut zu kennen, schien man an diesem Abend eines besseren belehrt zu werden. Hofstetter, ein ausgemachter Experte für alte Musik, war es in extremer Weise um die Erzeugung eines historischen Klangbildes zu tun, woraus mannigfaltige Abweichungen seiner Lesart von den Auffassungen anderer Dirigenten resultierten. Die Anlehnung an die historische Aufführungspraxis ergab ein sehr ungewohntes und hartes Klangbild mit wenig romantischen und emotionalen Klängen. Darüber hinaus setzte Hofstetter zusammen mit dem prägnant und intensiv aufspielenden Philharmonischen Orchester Gießen auf fast schon barockmäßig anmutenden Phrasierungen und verteilte die Akzente gänzlich neu. Die Sänger ließ er Appoggiaturen singen, die heute in keiner „Freischütz“-Partitur mehr stehen, aber anscheinend zur Entstehungszeit des Werkes üblich waren. Als Beispiel dafür sei nur die bis in extreme Spitzentöne vordringende Verzierung genannt, die Agathe im Es-Dur-Terzett im zweiten Akt bei der Wiederholung des Wortes „Schreckensschlucht“ auszuführen hatte.
Bei den gesanglichen Leistungen hielten sich Positiva und Negativa die Waage. Drei Sänger sind es, die angesichts ihrer hervorragenden Leistungen besonderer Erwähnung bedürfen: Sarah Wegener avancierte in der Rolle der Agathe zu Recht zum Publikumsliebling. Wunderbar, wie sie ihren bestens focussierten, warmen und gefühlvollen Sopran, der in jeder Lage gleichermaßen gut ansprach und über eine enorme Ausdrucksintensität verfügte, ebenmäßig und geradlinig dahinfliessen ließ. Ihr langer Atem ließ sie die breiten Kantilenen ihrer beiden Arien mit Bravour durchhalten und leistete einer einfühlsamen Linienführung und einem subtilen Legato Vorschub. Eine Glanzleistung erbrachte auch der junge Marcell Bakonyi, der sich mit seinem sonoren, klangvollen und ausdrucksstarken hellen Bass, der eine ausgezeichnete italienische Schulung aufweist, als Idealbesetzung für den Kaspar erwies. Und von dem ebenfalls ungemein markant und kräftig, dabei bestens gestützt singenden Ottokar von Adrian Gans, der zudem über ein phänomenales hohes ‚gis’ verfügte, hätte man gerne mehr gehört. Diese drei Sänger haben sich wahrlich für die größten Bühnen qualifiziert. Ihnen steht ohne Zweifel eine große Karriere bevor. Solide, wenn auch nicht außergewöhnlich gaben der noch aus seiner Pforzheimer Zeit her gut in Erinnerung gebliebene Aleksey Ivanov den Kuno und der Bariton Tomi Wendt die kleine Partie des Kilian. Die restlichen Solisten waren problematisch. Das begann schon bei Eric Laporte, der mit seiner typisch deutschen Stimme, die über keinerlei Körperstütze und über kein appoggiare la voce verfügt und obendrein sehr halsig und fast nur in einem monotonen Einheits-Forte geführt wurde, dem Max überhaupt nicht gerecht wurde. Nur mit einem Hauch von Stimme, dünn und kopfig sang Naroa Intxausti das Ännchen. Ein ebenfalls recht flachstimmiger und vokal nicht gerade große Autorität ausstrahlender Eremit war Tobias Schabel. Die letztgenannten drei Gesangssolisten sollten dringendst darum bemüht sein, ihre Stimmen in den Körper zu bekommen! Der Ort der richtigen Stütze ist das Brustbein bei einer gleichzeitigen kaum merkbaren Gegenbewegung, begleitet von ständigem Gähnen. Die aus dem Jugendchor Stadttheater rekrutierten Brautjungfern bewegten sich mit ihren gänzlich unfertigen Stimmen jenseits von Gut und Böse. Und wenn bei dem von Jan Hoffmann einstudierten Jägerchor immer wieder ein grell klingender Tenor die Stimmführung übernahm, war das für den Gesamteindruck nicht gerade positiv.
Ludwig Steinbach, 20. September 2012, Der Opernfreund