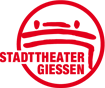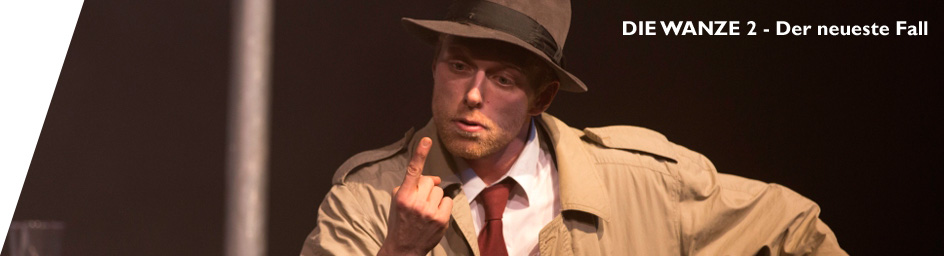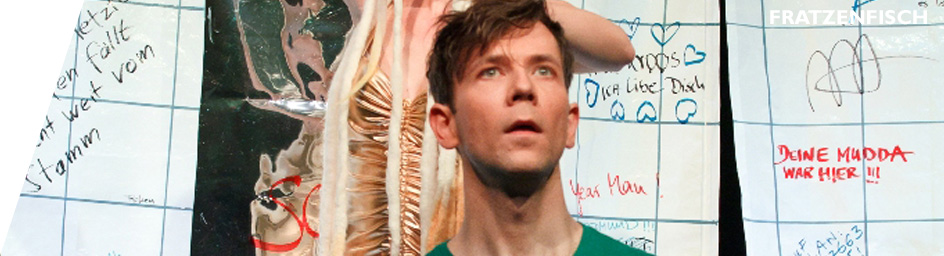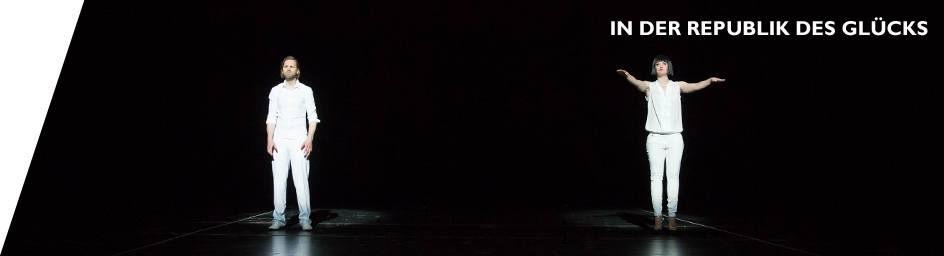Freikugeln im Tollhaus - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Webers „Freischütz“-Oper in Wuppertal und Gießen
Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ gilt als deutsche Nationaloper, weil der deutsche Wald darin eine Hauptrolle zu spielen scheint. Eine Nationaloper wird aber eher dadurch definiert, welche Rolle das jeweilige „Volk“ in ihre besetzt. Insofern wären Wagners „Meistersinger“ eher geeignet, die „Deutsche Nationaloper“ zu repräsentieren. Und der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, ein „Meistersinger“-Bewunderer, formulierte dazu die treffende Begründung: „Das Volk – im ersten Akt betet es, im zweiten prügelt es und im dritten ruft es ´Heil!´ und wählt sich einen Führer, fürwahr eine deutsche Nationaloper“.
Im „Freischütz“ dagegen beschränkt sich der Anteil des Volkes auf ein Schützenfest sowie auf den bekannten Jägerchor. Also auf eine Art Vereinsmeierei, die zwar auch deutsche Mentalität aufweist, aber nicht so dominierend die anderen Perspektiven des Werkes überstrahlt. Diese siedeln vor allem in der Romantik und deren tiefenpsychologischen Schichten. „Der Freischütz“ ist auch ein Exkurs über die Gefährdung der Seele. Dunkle Romantik stellt sich gegen die Helligkeit der Aufklärung, Psychoanalyse verdrängt die Vernunft. Ruth Berghaus hat das einmal in ihrer legendären Zürcher „Freischütz“-Inszenierung atemberaubend klar herausgearbeitet. Auf der Bühne war damals kein Wald zu sehen, dessen Bäume eher die Sicht, in die Ferne, in die Tiefe, zu behindern pflegen.
Auf den deutschen Wald wollen auch zwei aktuelle „Freischütz“-Inszenierungen nicht bauen. In Wuppertal präsentiert er sich nur in verarbeiteter Form: als Bretterzaun, der die Szene wie eine Palisadenbefestigung im Wilden Westen umstellt. Später, nach dem Freikugelgießen in der Wolfsschlucht, liegen die Bretter kreuz und quer als Trümmerberg auf der Bühne – vielleicht eine Chiffre für das heutige Waldsterben? Jungen Regisseuren (hier ist es Andrea Schwalbach) kommen ja immer wieder allerlei solche Einfälle in den Sinn. Die Dramaturgie der Wuppertaler Aufführung hat dabei sorgfältige wissenschaftliche Arbeit geleistet: Sie ergänzt das Originallibretto durch Auszüge aus der Erzählung „Der Freischütz“ – aus dem „Gespensterbuch“ von Johann August Apel und Friedrich Laun – sowie durch Zaubersprüche aus der „Deutschen Mythologie“ von Jakob Grimm. Bei Apel und Laun endet alles in der Katastrophe: Vater, Mutter, Braut tot, der Freischütz heißt Wilhelm und endet im Irrenhaus.
Das klingt fast interessanter als bei Weber und seinem Librettisten Friedrich Kind. Und eine ingeniöse Regie á la Hans Neuenfels hätte daraus sicher einen theatralisch fulminanten Aufreger gezaubert. Schwalbach dagegen ordnet artig die Szenen an, projiziert alles irgendwie auch in unsere Gegenwart und lässt in der Wolfsschlucht Bretter und Getier munter durch die Lüfte fliegen (Ausstattung: Nanette Zimmermann). Am Ende muß Kaspar (John in Eichen) wie in einem italienischen Verismo-Schinken vokal verröcheln. Nur in die psychischen Dimensionen der Figuren dringt die Regie selten ein. Banu Böke als Agathe, Niclas Oettermann als Max und Dorothea Brandt (Ännchen) gestalten ihre Partien engagiert. Seltsam eindimensional die orchestrale Darstellung durch das Symphonieorchester Wuppertal unter Florian Frannek.
Wer aber sehen möchte, wie Max alias Wilhem ins Irrenhaus abgeführt wird, der muss ein Haus weiter zur „Freischütz“-Inszenierung von Nigel Lowery, nach Gießen. Lowery hatte einmal, in Basel war es, Humperdincks „Hänsel und Gretel“ so als Horror-Picture-Show in Szene gesetzt, dass Mütter mit ihren Kindern entsetzt hinausgelaufen sind. Beim „Freischütz“ zeigt er sich zahmer, gleichwohl verleugnet er seine Vorliebe fürs Verrückte nicht. Scheinbar „normal“ läuft zunächst alles ab. Nur ein herumspringender Narr mit Königskrone irritiert. Am Ende aber löst sich alles in Regisseurswohlgefallen auf. Der Narr entpuppt sich als Fürst Ottokar, die Geschichte spielt im Tollhaus, und die Nerven aller Beteiligten sind von Beginn an zerrüttet. Der Eremit (Tobias Schabel) zeigt sich als Nervenarzt im weißen Kittel, Agathe wirkt etwas wirr – Sarah Wegener singt und spielt die Partie wunderbar, anrührend im Tonfall, mit bewegendem Ausdruck: Man möchte die Sängerin einmal in einer anderen Inszenierung als Agathe erleben, dann könnten Erinnerungen an Elisabeth Grümmer lebendig werden. Und Max, kräftig gesungen von Eric Laporte, wird in Zwangsjacke abgeführt von den Krankenpflegern.
Das hört sich nicht nur billig effekthascherisch an – es ist es auch. Die Irrenhaus-Chiffre sollte nun für lange Zeit verboten werden. Immerhin ließ sich Lowery, auch als sein eigener Ausstatter, treffende, expressionistische Bühnenbilder einfallen: verschobene Perspektiven, schräge Linien, alles in dunklem Grün, durchsetzt mit hellen Lichtflecken. Das signalisiert optisch, dass hier mit den Menschen nicht alles stimmt: dass sie in einer großen Angst leben, weil sie die Abgründe ahnen, aber nicht wissen, wo diese lauern.
Unter der inspirierenden Begleitung durch das Philharmonische Orchester Gießen unter dem nach Gieße zurückgekehrten Michael Hofstetter agiert das Ensemble engagiert und auf respektablem sängerischen Niveau. Man muss sich überhaupt wundern, dass Theater wie in Wuppertal oder Gießen trotz zunehmender finanzieller Pressionen solche Aufführungen herausbringen können. Die schleichende Erosion in unseren Theatern, den kleinen und mittleren vor allem, nähert sich allmählich dem kulturpolitischen Skandal.
Gerhard Rohde, 22. September 2012, FAZ