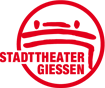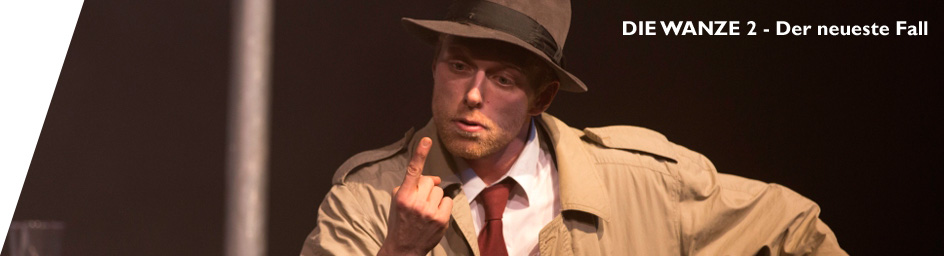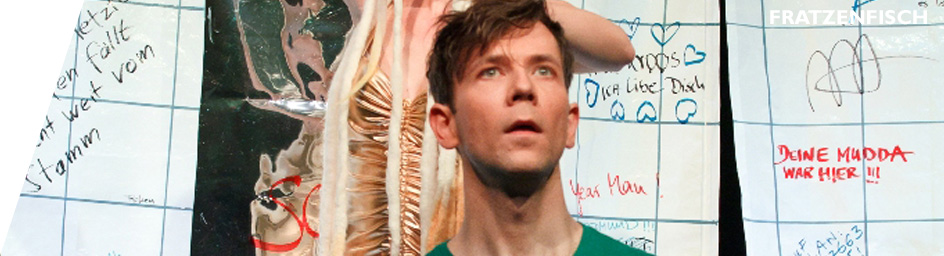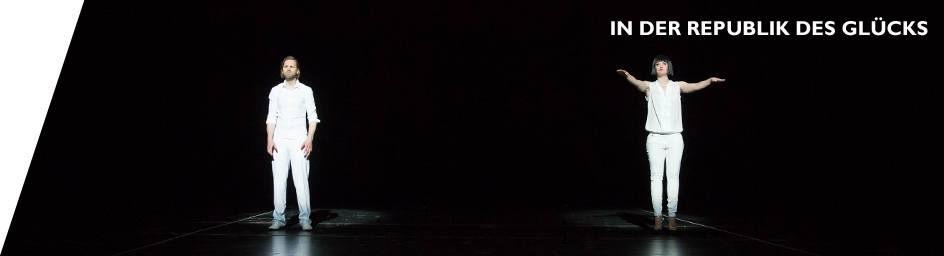GIESSEN: DER FREISCHÜTZ – Der Neue Merker online
GIESSEN: DER FREISCHÜTZ
Der Probeschuss ist abgeschafft. Dafür gibt’s für Max ein Probejahr – oder auch mehr – im Psycho-Knast. Nigel Lowery hat in seiner Gießener Inszenierung von Webers „Freischütz“ das Ende des unglücklichen Wilhelm aus der Vorlage für das Libretto von Johann August Apel und Friedrich Laun aufgegriffen. Dort endet Max im Irrenhaus. Dass die christlich-aufklärerische Botschaft am Ende von Webers Oper eine ziemlich radikale Abkehr vom trostlosen Schluss der Original-Novelle bedeutet, bleibt unberücksichtigt.
Was Lowery davon hält, wird schon im Lauf der Vorstellung deutlich: Agathe spricht zwar von den schützenden weißen Rosen des Eremiten, aber Kaspar zerbröselt die Blüten genüsslich. Die Hoffnung wird zwischen seinen Fingern zerrieben. Folgerichtig verkündet die finale Botschaft kein Geistlicher, sondern ein Hoherpriester der Moderne: der Anstaltspsychiater im weißen Arztmantel, flankiert von einer Schar von Krankenschwestern mit Kreuzen auf der Brust.
Sieht man davon ab, dass Lowery wie die meisten Regisseure der Botschaft des Weber’schen Finales ein Bekenntnis zur Hoffnungslosigkeit entgegenstellen, ist das Ende konsequent entwickelt. Die Irrenhaus-Chiffre, ausgelutscht wie kaum ein anderes Versatzstück der Regietheater-Einfallslosigkeit, sitzt ausnahmsweise an der richtigen Stelle – und das nicht wegen des Rückgriffs auf die literarische Quelle. Denn Lowery versetzt seinen „Freischütz“ in eine latente Gewalt-Gesellschaft und wählt als sein eigener Bühnenbildner ein ausdrucksstark verfremdetes Ambiente. Mit wildem Strich gemalte Bilder, Elemente von Grusel-Comics, Motive provinzieller Verlorenheit und Kälte wie aus – expressionistisch gesteigerten – Bildern von Edward Hopper: Die Welt ist einsam, unwirtlich.
Es ist die Welt, in der Amokläufer heranwachsen. Bettina Munzer steckt den Chor in Flanell-Karohemden und Käppis, wie man sie bei amerikanischen Reisegruppen sieht. Kuno tritt mit Sonnenbrille und dem Uniformhemd eines Sherriffs auf. Und statt des traulichen Forsthauses, in dem sich der Urältervater in Öl von der Wand herabbewegt, finden wir uns in der Waffenhandlung Kuno wieder: Die National Rifle Association lässt grüßen.
Wer in einer solchen Gesellschaft verschießt, ist raus. Zum Ballern trifft man sich nicht in der deutschen Dorfschänke, sondern in einem Holzhaus, das auch im Mittelwesten der USA stehen könnte, mit Schießständen und Pappkameraden hinter den Bohlen. Agathe ist ein braves Schulmädchen – dunkelblaues Kleid, weißes Krägelchen. Max wandelt sich vom Außenseiter zum Amokläufer: Mit Gesichtsmaske und Schnellfeuergewehr taucht er in Kunos Verkaufsraum auf, wo die Damen – Agathe und Ännchen – in genau diesem Outfit eine Schaufensterpuppe ausstaffiert haben.
Der psychische Zusammenbruch des labilen Ichs ereignet sich in der Wolfsschlucht: Der Guss von Kugel Nummer Sieben wird von einem filmischen Amoklauf begleitet, in dessen schemenhaften Szenen aus der Sicht des Schützen junge Mädchen, gekleidet wie Agathe, wahllos niedergemäht werden. Zum Schlussakkord zeigt sich im Hintergrund der Szene – aufrecht wie ein archaisches Idol – ein Riesenpenis: Sexuelle Versagensangst als Urgrund mörderischer Gewalt. Gut freudianisch.
Lowery zieht sein Konzept konsequent durch: Ännchen ist ein schon etwas tüttelig gewordenes älteres Mädchen mit sauber ondulierten grauen Haaren, halb altjüngferlich prüde, halb von der experimentellen Keckheit einer zu kurz Gekommenen, die es auch in ihrem Alter noch probieren würde. Dass der Geist Nero, der Kettenhund war: Agathe hat’s wohl schon x-Mal gehört und nimmt der Erzählerin die Pointe aus dem Mund. Kaspar entsteigt in Maxens Szene („Nein, länger trag’ nicht die Qualen….“) dem Spiegel am Schrank, richtet das Gewehr auf die Stirn des Verzweifelnden.
In der Wolfsschlucht drehen sich die beiden Rücken an Rücken um eine gemeinsame Achse; der Dialog mit Kaspar nach dem Kugelguss gerät zum inneren Zwiegespräch: Max und Kaspar – das kennen wir schon – sind zwei Aspekte einer Persönlichkeit. Der dunklen Seite entledigt sich Max um den Preis seiner psychischen Gesundheit. In diesem Moment ist das Ewige Licht am Bühnenportal schon längst gelöscht: In dieser Welt die Gegenwart Gottes oder auch nur eines versöhnenden oder heilenden Prinzips anzunehmen, wäre abseitig. Agathes Hoffnung, ausgedrückt in ihrer Arie „Und ob die Wolke…“, symbolisiert wie in der grandiosen Frankfurter Inszenierung Christof Nels aus den achtziger Jahren durch einen gemalten Lichtstrahl, ist erstickt.
Die Jungfern – „echte“ Mädchen aus dem Jugendchor des Theaters – mit der Totenkrone im Gepäck sind Abgesandte aus Vampir- und Zombiefilmen mit spinnwebigen Haaren und dunkel umrandeten, stieren Augen. Einen seiner eindrücklichsten bildnerischen Einfälle hat Lowery für den Beginn der Wolfsschluchtszene: Da tasten sich die Scheinwerfer eines einsamen Autos auf einem nächtlichen Waldweg durch gespenstisch vorbeihuschende Bäume (Video: Martin Przybilla). So gelingt es sogar heute noch, dem Zuschauer einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen! Manfred Wende setzt das Licht so ein, dass die Bilder eher Ahnungen als definierte Eindrücke bleiben.
Musikalisch bemüht sich der neue Gießener GMD, Michael Hofstetter, um eine verschlankte, geschärfte Lesart, wie sie Nikolaus Harnoncourt in seiner „Freischütz“-Aufnahme vorgeschlagen hat. Mit dem wackeren, aber in spieltechnischer Hinsicht oft unsauberen, klanglich anfechtbaren Gießener Orchester gelingt das nur bedingt. Das Cello-Solo in der Ouvertüre klingt glasig, die Hörner kämpfen sich durch, die Violinen spinnen einen dünnen melodischen Faden. Hofstetter dirigiert dramatisch zupackend, zeigt auf die rhythmischen Strukturen, neigt eher zum pointierten Non-Legato als zu schwärmerisch verbindenden Bögen. Lyrische Momente neigen zu anämischem Ton. Mit den Farben des Orchesters geht der Dirigent höchst aufmerksam um; selten hat man die Bläserakkorde, die Kaspars „Schweig, damit dich niemand warnt…“ begleiten, so fahl und drohend gehört. Hofstetter will keinen Mischklang, sondern klare Konturen und klangliche Reibungen: ein Konzept, das aufgeht. Sein Grundtempo ist rasch, aber nicht verhetzt; Details werden nie überbügelt.
Im Ensemble überzeugen Naroa Intxausti als Ännchen und vor allem Sarah Wegener als Agathe. Sie hat keine dramatische Stimme, aber einen gut geführten, zu erfüllten Legati und sicherer Steigerung fähigen lyrischen Sopran mit feinen Farben und innigem Piano. Die Freiheit für Verzierungen nimmt sie sich; so klingt „Dort in der Schreckensschlucht“ wie für Rezia komponiert. Eric Laporte singt den Max genau richtig zwischen Heldischem und Lyrischem, aber das Legato und das eine oder andere Crescendo bleiben dünn. Marcell Bakonyi ist ein imposanter Kaspar, dem im Eifer der Verführung seines Waffenkumpels Max manchmal die Kontrolle über die Position der Stimme entgleitet.
Tobias Schabels Psychiater mit sämigem Bass kann den Klang runden; Calin Valentin Cozma überzeugt als Kuno vokal wie darstellerisch, ebenso Tomi Wendt als Kilian. Adrian Gans geistert schon anfangs als irrer König durch die Schützenschar und entlarvt sich am Ende als Ottokar, wenn er das „Scheusal“ aus voller Kehle plärrend in die Wolfsschlucht verbannt.
Der Chor singt oft laut und grob und im Jägerchor hart an der Grenze zur Parodie; Lowery lässt dabei ein sexy „Bunny“ sich an der Stange rekeln. Man ahnt schon, dass die Herren mit entblößten Oberkörpern bald einem anderen als dem jagdlichen Waidgeschäft nachgehen. Trotz der Buh-Rufe: Gießen hat einen „Freischütz“ herausgebracht, der im Wettrennen der Deutungen dieser viel gespielten Oper weit vorne liegt. Darauf darf sich das Theater, das wirklich nicht zu den finanziell gesegneten Musentempeln gehört, etwas einbilden!
Werner Häußner, 15.09.2012, Der Neue Merker online