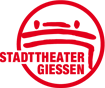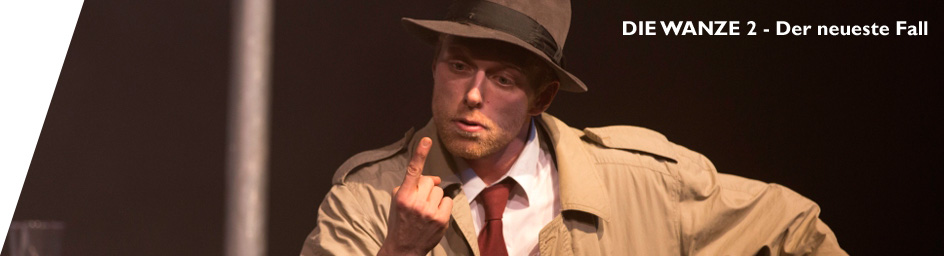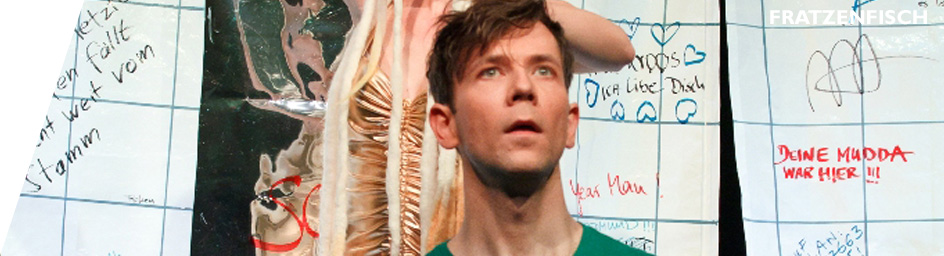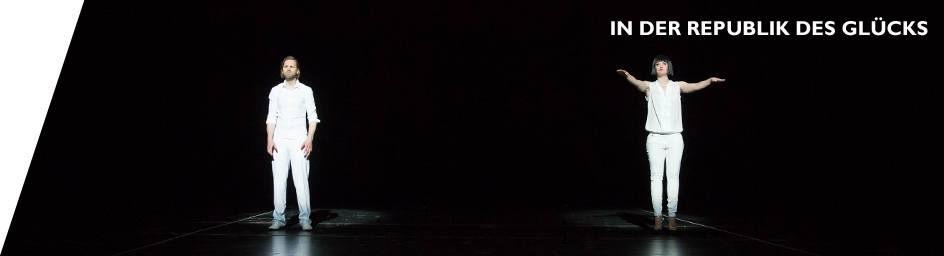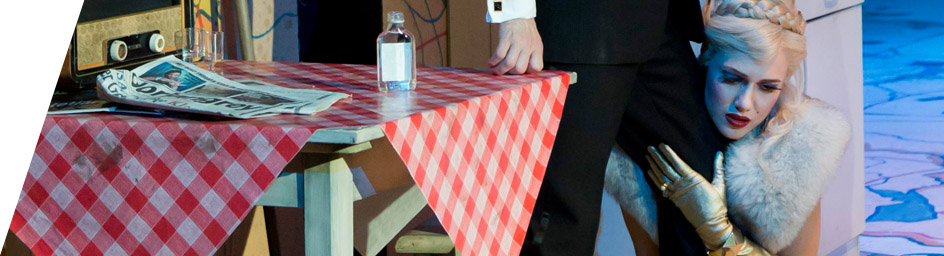»Viktoria und ihr Husar«: Operetten-Ironie im Stadttheater - Gießener Allgemeine Zeitung
»Viktoria und ihr Husar«: Operetten-Ironie im Stadttheater
Kaleidoskop mit Zeitkritik: Die Operette »Viktoria und ihr Husar« von Paul Abraham wird im Stadttheater gegen den Strich der Nachkriegsjahre gebürstet. Nicht allen Besuchern gefällt das.
Schon zu Beginn hat die Romantik ausgegeigt. Mit dem Deal, dass Janczi seine Violine dem Aufseher schenkt, damit der ihn und Husarenrittmeister Koltay aus der Gefangenschaft in die Freiheit entlässt, wird es nichts: Koltay und Janczi werden erschossen. Was in den kommenden knapp drei Stunden folgt, ist nur ein Traum. Ein politisch aktueller und gegen den deutschen Operettenstrich gebürsteter, ein Rassismus und Diskriminierung verteufelnder Traum des jungen Regie- und Ausstatterduos Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka.
Das Publikum im ausverkauften Stadttheater goutierte am Samstagabend die Premiere der 1930 uraufgeführten Operette »Viktoria und ihr Husar« von Paul Abraham mit gemischten Gefühlen. Die Protagonisten auf der Bühne und im Orchestergraben wurden mit Beifall überhäuft. Unter den langen, aber nicht epischen Schlussapplaus mischten sich lautstarke Buhs gegen die Regiearbeit. Beim Hinausgehen fiel der Begriff »Etikettenschwindel«.
Wer auf die Heile-Welt-Süße aus der Ära eines Rudolf Schock gehofft hatte, war am Ende tatsächlich geschockt, weil enttäuscht. Alle anderen hatten an dem Vexierspiel ihren Spaß.
Diese Erstaufführung einer Rekonstruktion der Operette von Henning Hagedorn und Matthias Grimminger zeigt nach einem Zeitlupeneinstieg stets zwei oder drei Erzählebenen parallel. Die Bühne ist eine große Weltkarte. Vorn links und rechts wird das ungarische Bauerndorf Dorozsma angedeutet. Bürgermeister Pörkölty (laut und gut: Rainer Hustedt) und seine Frau Piroska (solide: Marie-Louise Gutteck) kümmern sich um Baby Miki (Sebastian Songin), das im Lauf der Geschichte zum Teenager und einem gegen enge Konventionen aufbegehrenden jungen Mann heranwächst.
Ein Foto an der Wand nimmt die Besucher mit auf diese Zeitreise. Nach Hitler, Stalin und ungarischen Konsorten prangt das Konterfei von Ministerpräsident Viktor Orbán im Raum und verweist auf die aktuelle Angst vieler Künstler in diesem Land.
Im dritten Akt ist das Bauerndorf eine Karikatur seiner selbst mit Bewohnern in billigen Trainingsanzügen – als böser Kontrast zum rot-weiß-grünen Ungarn-Schmelz der Nachkriegsoperette. Pörkölty und Piroska schreien sich als Persiflage den Titel »Ja so ein Mädel, ungarisches Mädel« aus dem Leib. Spätestens jetzt merkt auch der Letzte im Saal, was hier gespielt wird: Operettenanarchie mit Zeitkritik.
In der Mitte der Bühne tobt das eigentliche Geschehen. Wenn Viktoria im revueartigen Ambiente oben auf einer Showtreppe als Stempel einer sich aufblätternden roten Blüte entsteigt, hat das jenes Flair, auf das viele hofften. Aber bereits hier karikieren die Regisseurinnen das Sujet.
In einem Videoeinspieler sprechen die Akteure im Straßeninterview über Ungarn und die dazu offenbar in den deutschen Köpfen umhergeisternden Vorstellungen – das gehört nicht zum eigentlichen Stück, ist aber wie vieles, was sich Szemerédy und Parditka ausgedacht haben, sehenswert. Das Regie-Duo hat den Klischees den Kampf angesagt; dazu leisten vom Schnürboden herabschwebende Requisiten wie King Kongs Gorillahand und ein überdimensionaler Gulaschtopf ihre Dienste.
Im Orchestergraben drückt Operettenexperte Florian Ziemen mächtig auf die Tube. Die Hits vom Foxtrott bis zum englischen Walzer werden über die Bühne gehetzt wie die Sau durchs Dorf. Nicht allen Songs bekommt dieser Umgang. Das faschingsballkolorierte »Nur immer Ping Pong«, das rund um eine Tischtennisplatte gesungen und getanzt wird, sowie »Meine Mama war aus Yokohama« gehen im Tohuwabohu beinahe unter. Der vorzügliche Chor des Stadttheaters (Einstudierung: Jan Hoffmann) muss sich während des bunten Reigens siebenmal umziehen.
Andersrum betrachtet: So viel atemlose Aktion wie bei »Viktoria« herrschte lange nicht auf der Stadttheaterbühne. Zu verdanken sind die Körperverenkungen dem hauseigenen Tanzsextett um dessen Chef Tarek Assam – Stimulanz für Auge und Ohr bietet der gesteppte und schenkelgeklopfte Csárdás.
Der Jazzsound im Graben wird vom lauten und harten Blech dominiert. Zwei Schlagwerker und zwei Pianisten bilden das Fundament. Suosafon, Banjo und zwei Saxofone – von Gast-Jazzmusikern gespielt – geben der Partitur Saures. Dem jüdischen Komponisten, dessen »Jazz-Operetten« im Nationalsozialismus geschmäht und danach verwässert wurden, hätte es gefallen. Ziemen hielt das Orchester gut auf Kurs.
Auf der Bühne ist Maria Chulkova die ungekrönte Königin. In den beiden ersten Akten mit blonder Perücke und edler Abendrobe zur elitären Schönheit stilisiert, gibt sie im finalen Drittel vehement und mit eigenem dunklen Haarschopf die verzweifelte Viktoria. Den Höhepunkt des Abends, das zu Herzen gehende »Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände« – von Ziemen souverän intoniert –, singt die Haussopranistin mit betörender Reinheit. Ihr glitzerndes Timbre, das in den Höhen immer etwas tremoliert, überstrahlt sämtliche optischen und akustischen Einfälle. Die Chulkova allein ist einen Besuch des Stücks wert.
Dan Chamandy, als Heldentenor in Gießen eine Bank, gibt den lasziven Grafen Ferry. Als Geisha bezirzt er mit schauspielerischem Können und mutiert zum Schmachtschnitten-Chamandy. Naroa Intxausti mimt eine köstliche O Lia San, bleibt mit ihrem leichten Sopran aber hin und wieder hinter der Musik zurück. Tomi Wendt gefällt als Janczi. Der Hausbariton sieht mit dunkler Perücke und angeklebten Koteletten aus wie der vierte Mann der Ärzte. Wendt singt, agiert und spielt Geige mit großer Präsens. Calin-Valentin Cozma, ebenfalls an der Geige virtuos, ist ein stattlicher John Cunlight, Operettenspezialist Hauke Möller ein stimmlich beeindruckender Stefan Koltay und Anna Gütter eine quirlige Riquette. Die Soubrette hat ebenso wie Intxausti sichtlich Spaß an ihrer Rolle.
Das kritische Kaleidoskop auf dieser Weltkartenbühne beeindruckt im ersten Durchgang durch Übermut, Ironie und frischen Witz. Nach der Pause zeigt das Stück trotz der Tobsucht des Ensembles einige Längen. Gleichwohl ist diese Inszenierung ein Saisonhöhepunkt – nur die Rudolf-Schock-Fans bleiben besser zu Hause.
Manfred Merz, 19. November 2012, Gießener Allgemeine Zeitung