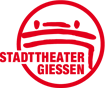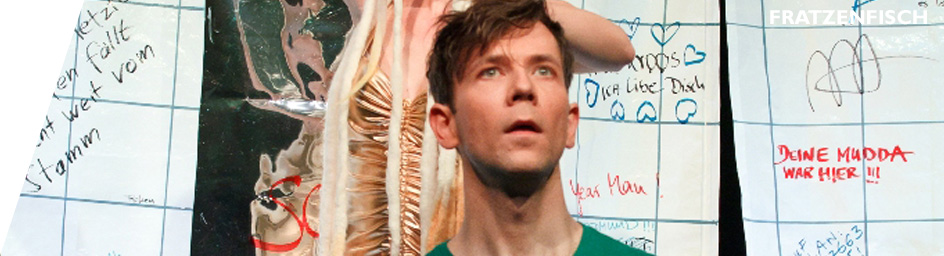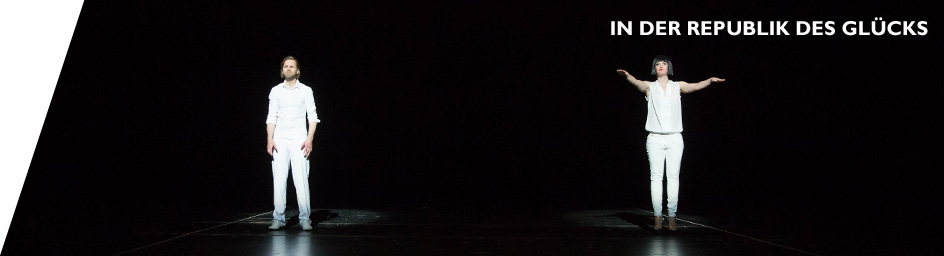Lulu die 2. - Der Opernfreund
Am Marterpfahl der Fremdbestimmtheit - Um es vorwegzunehmen: Das war ein rundum gelungener Abend auf hohem Niveau.
Mit der Uraufführung der von Eberhard Kloke verantworteten Neufassung von Alban Bergs Oper „Lulu“ für Soli und
Kammerorchester hat das Theater Gießen einen Coup gelandet, der diesem kleinen Haus alle Ehre macht und ihm in der
Opernlandschaft etwas mehr Beachtung verschaffen sollte als es bisher der Fall war.
Einmal mehr wurde deutlich, dass es gerade die kleinen Häuser sind, denen die besten Produktionen gelingen,
deren hochkarätige Leistungen aber angesichts der enormen Konkurrenz der sog. großen Häuser in der
Opernlandschaft meistens gar nicht richtig wahrgenommen werden - ein Missstand, der nicht akzeptabel ist.
Der in jeder Hinsicht gelungenen Gießener „Lulu“ wäre es sehr zu wünschen, dass ihr die Aufmerksamkeit zukommt,
die ihr zusteht.
Eberhard Klokes Neufassung des dritten „Lulu“-Aktes hatte bereits im Jahre 2010 in Stefan Herheims Kopenhagener
Produktion des Werkes, die in dieser Spielzeit auch in Dresden auf dem Spielplan steht, ihre gefeierte Premiere.
Auch in Augsburg und Erfurt war sie schon zu erleben. Mit dieser trefflich gelungenen Fassung schuf Kloke einen
interessanten Gegenentwurf zu der bekannten Bearbeitung von Friedrich Cerha, die im Jahre 1979 im Pariser Palais
Garnier in einer Inszenierung von Patrice Chéreau mit großem Erfolg aus der Taufe gehoben wurde.
Er hat das von Berg der Nachwelt vermachte fragmentarische Quellenmaterial einer eingehenden Analyse
unterzogen und es gekonnt in eine neue Form gegossen. Sein Anliegen war es, eine sowohl „authentische“ als
auch gleichermaßen theatralisch-musikalisch schlüssige Komplettierung herzustellen (so Kloke im Programmheft).
Diese Intention ist in hohem Maße aufgegangen. In einigen Punkten dürfte seine Komplettierung des Schlussaktes den
Vorstellungen Bergs eher entsprochen haben als die von Cerha gefundenen Lösungen.
Während dieser sehr viel Eigenes beisteuerte, beschränkte sich Kloke bei seiner Arbeit ganz rigoros auf die
von Berg hinterlassenen Notenskizzen. Die von diesem fertig komponierten Teile rührte er nicht an und setzte sie
als Fundament des dritten Aktes ein. Indes waren Änderungen und Auslassungen manchmal unvermeidlich.
Wo immer er auf Unklarheiten stieß, hat er diese kurzerhand eliminiert und eigene Vorschläge angeboten.
So entwickelte er an bestimmten Stellen ossa-Varianten und Optionen zur Kürzung von Passagen durch Vide-Sprünge,
auf deren Grundlage man eine eigene Lösung finden kann (vgl. Programmheft).
Diese Weglassungen bewirken eine Straffung, die rein musikdramaturgisch betrachtet, durchaus sinnvoll anmutet.
Im Paris-Bild ersetzte Kloke einige Musikpassagen, die man von Cerha her noch gut im Ohr hat,
durch gesprochene Dialoge. Eine ganz zentrale Änderung ist instrumentaler Natur: Bergs Klangspektrum und das Kolorit
des Bänkelliedes (siehe Programmheft) im Auge, hat Kloke in der Auseinandersetzung zwischen
Lulu und der Gräfin Geschwitz anstelle der Bläser, die Cerha einsetzt, ein ziemlich wehmütig klingendes Akkordeon
zum Einsatz gebracht. Die aus dieser instrumentalen Erweiterung des ursprünglichen Orchesterapparates
resultierende klangliche Tristesse ist sehr effektvoll.
Dem Rotstift zum Opfer fiel in der London-Szene das bis auf den Part des Alwa aus Cerhas Feder stammende bekannte
große Quartett, das bei Berg eigentlich das Kernstück des Aktes bilden sollte und das man trotz seiner historisch
begründeten Streichung schon etwas vermisste. Dasselbe gilt für den ersten Teil der herrlichen Jack-the-Ripper-Szene,
in der Kloke leider in puncto Ausdrucksintensität das Niveau von Cerha nicht ganz erreicht. Dass seine Alternative zu Cerhas Version lebensfähig ist, haben inzwischen aber zahlreiche Aufführungen bewiesen. Und auch bei der hier zum ersten Mal präsentierten orchestralen Umgestaltung der anderen beiden Akte hat Kloke ganze Arbeit geleistet. Geschickt hat er die Zahl der Musiker von cirka 90 auf cirka 30 (ohne Bühnenmusik) reduziert und durch diese Neufassung die Oper auch für kleine Bühnen wie die Giessener spielbar gemacht. Damit einher geht eine große Klarheit und hervorragende Transparenz der Orchesterstimmen, wie man sie bei der Originalbesetzung nie gehört hatte und auf die auch Herbert Gietzen am Pult sein ganzes Augenmerk richtete. Bei aller an den Tag gelegter Durchsichtigkeit des von dem Philharmonischen Orchester Gießen erzeugten Klangteppichs, bei dem insbesondere die voll und intensiv aufspielenden Holzbläser nachhaltig auf sich aufmerksam machten, ließ er es aber auch an der erforderlichen Dramatik nicht fehlen. Insgesamt gelang ihm eine eindrucksvolle Gratwanderung zwischen lyrischer Empfindsamkeit - wunderbar Lulus äußerst gefühlvolles Liebesmotiv an Dr. Schön! - und eruptiven Ausbrüchen des Orchesters. Diese klangen in dieser Bearbeitung logischerweise nicht so fulminant wie sonst, Expressivität wurde von Dirigent und Musikern aber ganz groß geschrieben und mit einer bewundernswerten Ausdrucksintensität gespielt. Darüber hinaus hatte Herr Gietzen das diffizile Geflecht von Leitmotiven bestens im Griff und stellte die einzelnen Themen der dodekaphonischen Partitur mit großer Versiertheit heraus. Gut durchdacht und ansprechend war die Inszenierung von Thomas Oliver Niehaus, der dem Stück in Zusammenarbeit mit Lukas Noll (Bühne und Kostüme) einen abstrakten Anstrich verpasste. Mit Hilfe der Drehbühne ist ein schneller Wechsel zwischen den verschiedenen, durchweg in karges Schwarz-Weiß gehüllten Handlungsorten möglich. Dabei bleiben die Protagonisten ständig auf der Bühne. Wenn sie nicht gerade am Geschehen partizipieren, verweilen sie am Bühnenrand und warten auf ihren nächsten Auftritt. Wer sein Leben aushaucht, legt sich still vorne an die Rampe, ohne auf einer bestimmten Todesart (Schlaganfall, Verbluten, Erschießen usw.) zu bestehen. Wenn die Verblichenen am Ende der jeweiligen Szene dann von einem weiteren Mitspieler weggeschickt werden, verharren sie gleichwohl weiter am Bühnenrand und beobachten die Ereignisse. Man merkt: Mit Brecht und Tschechow kann der Regisseur gut umgehen. Das Ganze ist als Spiel im Spiel, als Theater auf dem Theater zu begreifen. Das ist ein alter Hut, der indes immer wieder effektiv ist. Die Männer des Stückes werden zu Beginn nicht mit bestimmten Tieren identifiziert. Die Schlange wird am Anfang vor geschlossenem Vorhang von den in einer Promenade hintereinander aufgestellten Hauptpersonen des Stückes ausgedrückt. Das einzige Tier, das ständig präsent bleibt, ist ein künstliches Zebra als Versinnbildlichung der Wandlungsfähigkeit der Titelfigur. Dem entspricht es, dass Lulu ständig ihr Kostüm wechselt. Eine kurze Jeanshose und ein Matrosenanzug gehören ebenso zu ihrer Ausstattung wie ein eleganter champagnerfarbener Hausanzug und ein Hochzeitskleid. Auch im Unterkleid ist sie mal zu sehen. Das Eva-Kostüm wird in dieser Inszenierung indes im Gegensatz zu den meisten anderen Produktionen dieser Oper ausgespart. Hinsichtlich Lulu selbst kommt Niehaus über vorhergegangene Regie-Sichtweisen nicht hinaus. Wie in vielen anderen Deutungen des Werkes stellt sie bei ihm eine Projektion von sexuellen Obsessionen der Männer dar. Diese beherrschen die Welt und projizieren ihre Schattenseiten, erotische Sehnsüchte und perverse Begierden auf einen weiblichen Katalysator, den sie unter anderem Lulu nennen. Diese Auffassung, die sich erkennbar an die Theorien Ludwig Feuerbachs anlehnt, ist nichts Neues mehr. Was aber neu ist, ist Niehaus’ Erkenntnis, dass die Projektion für die Männer lebensnotwenig ist. Wenn sie ihre negativen Charaktereigenschaften nicht von sich abspalten und in einer gerade zu diesem Zweck geschaffenen Figur sammeln können, die so gleichsam zu einem mosaikartig zusammengesetzten Teil ihrer selbst mutiert, sind sie dem Tode geweiht. Es erscheint nur zu verständlich, dass sie diesem Schicksal entrinnen wollen. Dieser Aspekt lässt so manche ihrer ansonsten recht anrüchig anmutenden Taten in einem milderen Licht erscheinen. Also: Nicht nur die sehr multipel gezeichnete Titelgestalt ist es, die hier eine Objektivierung erfährt. Dies trifft in noch viel stärkerem Maße auf die Männer zu, auf ihre namentlich genannten Gegenspieler und Begleiter wie auch auf die zahlreichen gesichtslosen Pappkameraden, die ebenfalls den ganzen Abend über präsent sind und wechselseitig ihre weiße und ihre schwarze Seite präsentieren. Das ganze Leben ist eben ein ständiger Wechsel von Gut und Böse. Demgemäß ist auch Lulu hier nicht ausschließlich als femme fatale aufzufassen. Zuerst gleichsam eine Marionette, die am Anfang symbolisch am Marterpfahl der Fremdbestimmtheit steht, versucht sie zunehmend sich dem Einfluss der sie umgebenden Männer zu entziehen und selber die Führung über ihr Leben zu übernehmen. In immer stärkerem Maße wird sie dem Bild, das sich die Männer von ihr gemacht haben und dem auch sie sich schließlich angeglichen hat, unähnlicher. Gleichzeitig als Täterin und Opfer geht sie in die Offensive. Ihr Versuch der Auflehnung ist indes zum Scheitern verurteilt. Das Aufeinanderprallen beiderseitiger Widersprüche zerstört die Welt in ihren Grundpfeilern. Ob sich aus dem entstandenen Scherbenhaufen eine neue Gesellschaft formen kann, bleibt abzuwarten. Es gehört zu den stärksten Bildern der Produktion, wenn sich Lulu im letzten Bild in Reisekleidern zu ihren drei verstorbenen, regungslos auf einem Diwan verharrenden Ex-Ehemännern gesellt. Sie schickt sich an, den gleichen Weg wie sie zu beschreiten und tritt bereitwillig die Reise in den Tod an. Das alles wurde von Niehaus mittels einer ausgefeilten Personenregie sehr geradlinig und ohne Effekthascherei in Szene gesetzt, wobei er großes technisches Können bewies.Auf beachtlichem Niveau bewegten sich die sängerischen Leistungen. In Alexandra Samouilidou vom Jungen Ensemble des Staatstheaters Mainz stand dem Stadttheater Gießen eine Lulu zur Verfügung, die mit ihrer beeindruckenden Leistung so manch berühmtere Rollenvertreterin an großen Häusern nachhaltig in den Schatten stellte. Selten hat man eine Lulu erlebt, die bis in die extremen Höhen so gut im Körper und unangestrengt singt wie Frau Samouilidou, ihren aparten Sopran dabei warm und gefühlvoll zu führen versteht und diesem darüber hinaus viele Nuancen und Farben zu entlocken weiß. Aber nicht nur ihre hervorragende gesangliche Leistung, der kleine Ermüdungserscheinungen im dritten Akt keinen Abbruch tun, vermochte nachhaltig für sich einzunehmen, auch schauspielerisch war die junge, überaus hübsch und attraktiv aussehende Sängerin eine Idealbesetzung für die Rolle. Sie verfügt über eine ausgeprägte schauspielerische Ader, die sie ohne Anlaufzeit bereits im ersten Akt derart ausgeprägt zum Ausdruck brachte, dass es eine Freude war, ihr zuzusehen. Mit großer Vehemenz zog sie jede Facette ihrer anspruchsvollen Partie, in der sie voll aufging. Die Welt hat eine neue Lulu. Und zwar eine ganz ausgezeichnete. Auf ihre weitere Entwicklung in dieser Partie darf man gespannt sein. Für die größten Häuser empfahl sich auch Adrian Gans in der Doppelrolle des Dr. Schön und Jack the Ripper. Es ist erstaunlich, über welch ausgeprägtes heldisches Bariton-Material und großes darstellerisches Charisma der noch junge Sänger bereits jetzt verfügt. Was er in puncto Stimmkraft und dramatischer Intensität bei durchweg hoher Ausdrucksstärke zu bieten hatte, war enorm und prädestinierte ihn nachdrücklich für das dramatische Fach. Es dürfte wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er die großen Wagner-Partien singen wird. Das Zeug dazu hat er zur Genüge. Lobenswert ist auch, dass er bei aller Prägnanz und guter Diktion seines Vortrags nie vergaß, die Stimme auf italienische Art und Weise zu führen. Von ihm wird man in Zukunft wohl noch einiges erwarten dürfen. Einen gefälligen Eindruck hinterließ auch Catalin Mustata als Maler, Neger und Journalist. Auch ihm ist eine ansprechende italienische Technik mit solider Körperstütze zu bescheinigen, womit er diese Charaktere ungemein aufwertete. Auch die Höhe bereitete ihm nicht die geringsten Probleme. Sogar den gefürchteten Spitzenton des Malers, bei dem sich andere Rollenvertreter oft in die Fistelstimme flüchten, was nicht zu goutieren ist, sang er voll aus. Mit vollem, emotional eingefärbtem Mezzosopran stattete Almerija Delic die Gräfin Geschwitz aus, die sie auch überzeugend spielte. Über einen soliden Stimmsitz verfügte auch Sora Korkmaz, die sich als Theatergarderobiere, Gymnasiast und Groom beachtlich schlug. Entwicklungsfähiges Stimmmaterial wies auch der Alwa von Dan Chamandy auf. Indes mangelte es seinem Tenor noch an der nötigen Körperstütze. Das gilt auch für den rauen und stark im Hals sitzenden Bass von Stephan Bootz’ Tierbändiger und Athlet, bei deren Darstellung der Sänger ganz schön Klischees bediente. Vokal nicht mehr ganz taufrisch präsentierte sich Monte Jaffe in der Partie des Schigolch. Er spielte ihn eher gutmütig als verschlagen und sprach mehr auf den Tönen als zu singen. Auch der mit den Rollen des Prinzen, des Kammerdieners und des Marquis schauspielerisch überzeugende Wojtek Halicki-Alicca hätte seinen Charaktertenor besser im Körper führen können. Solide gab Christian Steinbock, der auch für die Dramaturgie verantwortlich zeigte, den Medizinalrat, den Professor und den Polizeikommissär. In die Partien des Theaterdirektors und des Bankiers schlüpfte Tomi Wendt. Aleksey Ivanov (Diener) und Olga Vogt (Mutter) rundeten das Ensemble ab.
Ludwig Steinbach, Juni 2012, Der Opernfreund