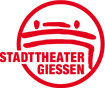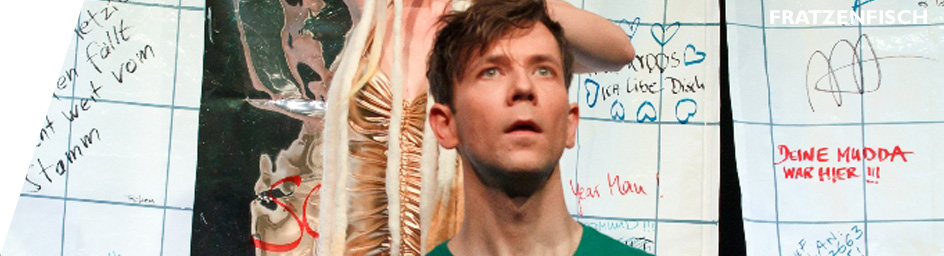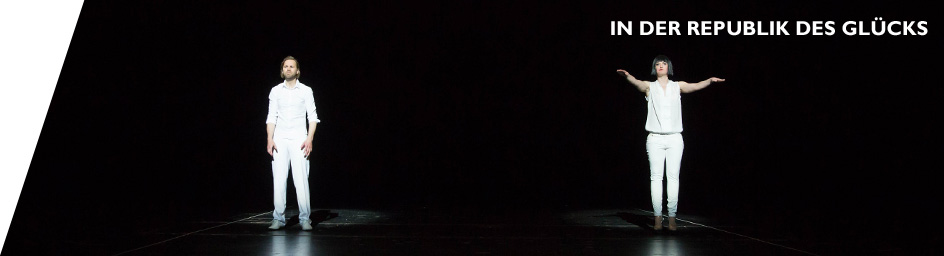Stadttheater zeigt »Mirandolina« auf der Lustmatratze - Gießener Allgemeine Zeitung
Dieser Lustmatratze geht die Luft aus: Im Großen Haus feiert die Oper »Mirandolina« von Bohuslav Martinu als deutsche Erstaufführung in einer Inszenierung von Andriy Zholdak Premiere.
Am Ende ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Regisseur Andriy Zholdak hält zwar sein Versprechen, der Handlung des Stücks die entblößte Schulter zu zeigen, doch Sodom und Gomorrha hat er nicht auf die Bühne gezaubert, wenngleich er die leichte Komödienkost intensiv beschwert. Der weithin unbekannten Oper »Mirandolina« des Tschechen Bohuslav Martinum (1890 - 1959), die am Sonntag im nicht ausverkauften Stadttheater in italienischer Sprache (mit Übertiteln) deutsche Erstaufführung feierte, tat der Theater-Desperado aus der Ukraine auf seine Art Gewalt an.
Mirandolina führt zusammen mit ihrem Diener Fabrizio ein Gasthaus in Florenz und wird von ihren Gästen umschwärmt. Nur der Cavaliere, erklärter Frauenfeind, sieht dem absurden Treiben kopfschüttelnd zu. Mirandolina beschließt, auch ihn zu verführen. Nach allerlei Geplänkel und Liebesgelüsten heiratet die Schöne am Ende ihren Diener. Dem Commedia-dell’arte-Textbuch von Carlo Goldoni aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mangelt es an Witz und überraschenden Wendungen, was ein Grund sein mag, weshalb die Oper kaum gespielt wird. Das denkbar dürftige Handlungsgerüst peppt Zholdak auf und erweitert es um eine mystisch-religiöse Ebene.
Der Regisseur setzt auf Schwarz und Weiß (und ein bisschen auf verruchtes Rot), auf Leben und Tod, wenn man so will, er lässt Wasser statt Wein fließen. Er bemüht Freud’sche Zwangshandlungen, religiöse Waschungen, Amors Pfeile, suggeriert philosophische Tiefe, baut am Ende ein Abendmahl auf und inszeniert konsequent am leichten Duktus der Oper vorbei. Das macht er so eindringlich, als wolle er den Tiefgang mit der Schaufel ins Stück hineinschippen – ähnlich wie bei seiner »Woyzeck«-Inszenierung in der Kongresshalle während des Büchner-Jahres 2013.
Zholdak erwartet vom Publikum Nehmerqualitäten. Zweieinhalb Stunden agieren die Protagonisten vor dem heruntergelassenen eisernen Vorhang, ehe der sich ganz am Schluss öffnet. Die Bühnentiefe beträgt zuvor knapp zwei Meter, der Orchestergraben ist sicherheitshalber vergittert, damit niemand hinabstürzt. Die triste eindimensionale Szenerie bleibt weithin düster, das Licht diffus, es kommt von den Seiten und sorgt nur selten für erhellende Momente. Links und rechts vor den seitlichen Eingängen zwei Türen, dazu Kameraeinspielungen, die den jeweiligen Bühneneingang observieren – so kann das Publikum sehen, wer gleich den Raum betritt (die NSA lässt grüßen). Links stehen Utensilien bereit, mal eine schwarze Waschmaschine, auf der Wäsche gebügelt wird, mal ein Sofa zum Fummeln oder eine Luftmatratze, die zur Lustmatratze wird.
Acht Sänger gibt es bei Martinu, keinen Chor, weshalb Zholdak ein paar Statisten einbaut. Die sind unter anderem für die Fleischeslust zuständig, aber Myriel Bischoff, Theresa Gehring und die Jünglinge belassen es bei Geknutsche und Gefummel. Jemina Coletta hüpft als pistolenbewehrtes Engelchen vor dem dritten Akt ganz in Weiß während des Saltarellos auf der Bühne umher und erschießt den Cavaliere und seinen Bodyguard gleich mehrfach. Beide stehen wieder auf, weil sie im Verlauf der Handlung noch gebraucht werden. Ein halb nackter Jüngling wird jesusgleich an den eisernen Vorhang genagelt, oder aber die halb entblößten Dienstmädchen verharren in dieser Pose. Was die Liebespaare auf der einen Seite der Bühne singen, stellen die Statisten auf der anderen Seite dar. Doch keine Sorge: Das Kopulieren wird nur angedeutet, wie das Laster per se, um Mirandolinas Neigungen zu visualisieren.
Zholdak schreibt sich das Sexuelle, das Halbnackte (gegen das Ganznackte wie bei seiner verbotenen »Romeo und Julia«-Version in der Ukraine wurden im Vorfeld Stimmen laut) auf die süffisante Fahne. Er will der westlichen Gesellschaft – der Regisseur lebt seit sieben Jahren in Berlin – den Spiegel vorhalten.
Freud’sches Leben atmet die Figur des alten Mannes (Klaus Peter Unfried), der aussieht wie Thilo Sarrazin. Der Zwangshandlung verschrieben, schiebt er sich seine Brille auf der Nase zurecht und widmet sich dann mit einem Blick ins Publikum seinem Schnäuzer, links und rechts per Fingerzeig. Das macht er fast jedes Mal, wenn er auf- oder abgeht – und dieser Sarrazin, eine Art Faktotum, geht oft auf und ab.
Im ersten Akt säubert er die Bühne und schleppt Topfpflanzen und Blumen herbei – darunter auch bibelschwere weiße Lilien. Im zweiten Akt räumt er das Grünzeug wieder weg. Im Dritten reinigt er das Linoleum vor dem Showdown. An der Wand hängen Jesus- und Marienfotos. Ein großes Marienbild wird durch eins ersetzt, das die andächtig betende Angela Merkel zeigt. Mit der ursprünglichen Komödie hat das nichts zu tun.
Musikalisch bewegt sich die 1959 uraufgeführte Oper im erweiterten tonalen Korsett. Die Partitur ist klangschön, auch weil Martinu Rhythmen gegeneinanderstellt und mit wechselnden Takten arbeitet. Manches ist versatzstückartig aufgereiht, was dem Orchester Konzentration abverlangt. Ohrwurm-Arien gibt es nicht. Die Musik erklingt federnd und fordernd zwischen Rossini und Dvorak, nur moderner. Generalmusikdirektor Michael Hofstetter führt das Philharmonische Orchester im Graben zu einer Glanzleistung. Die heimlichen Stars des Abends sind die Partitur und ihre Umsetzung.
Auch die Sänger können sich hören lassen. Francesca Lombardi Mazzulli als Mirandolina spielt und singt mit berückender Schönheit. Der glockenklare Tenor von Eric La-porte (Conte Albafiorita) ist wie immer ein Quell der Freude. Haus-Bassbariton Tomi Wendt (Cavaliere Ripafratta) liefert eine blitzsaubere Partie. Calin Valentin Cozma (Marchese Forlimpopoli) tönt voluminös. Naroa Intxausti (Hortensia) und Stine Marie Fischer (Dejanira) bleiben rollenbedingt unterbelichtet. Tenor Vepkhia Tsiklauri als Diener des Cavaliere setzt humoristische Akzente. Ralf Simon (Fabrizio) wurde von Intendantin Cathérine Miville vor der Premiere zu Recht als indisponiert angekündigt.
Als Komödie funktioniert diese »Mirandolina« nicht, doch gegen Zholdaks mystisch angehauchtes Epos spricht das Sujet. Nicht mal einen Eklat, der das Publikum in Scharen hätte in die Aufführung rennen lassen, gibt es. Mit dieser Inszenierung wird der Regisseur keinen Blumentopf gewinnen.
Manfred Merz, 01. April 2014, Gießener Allgemeine Zeitung