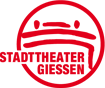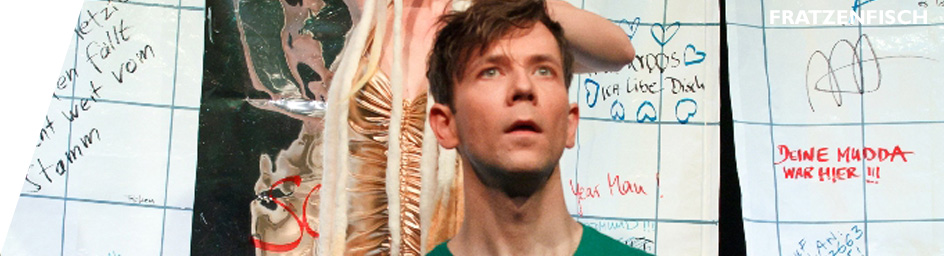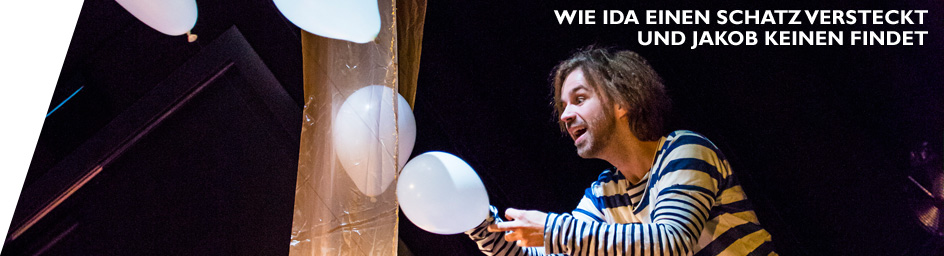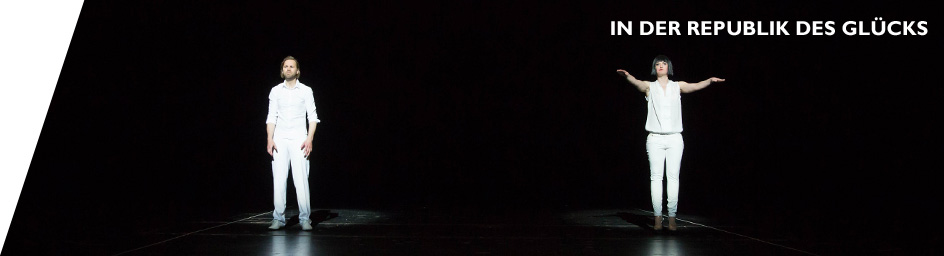Dieser Kehraus fällt im Stadttheater aus dem Rahmen - Gießener Allgemeine Zeitung
Als letzte Produktion des Musiktheaters in dieser Spielzeit zeigt das Große Haus eine weithin unbekannte Oper: den »Kehraus um Sankt Stephan« von Ernst Krenek.
Diese Oper hat es in sich. Musikalisch, szenisch, inhaltlich. Regisseur Hans Hollmann gebührt Lob. Die Inszenierung des Theatertausendsassas aus Österreich ist straff und ideenreich. Der 82-Jährige arbeitet die Pointen erfrischend stilsicher heraus. Hier staubt nichts. Die Musik aus dem Graben erklingt stimulierend. Die Protagonisten auf der Bühne agieren und singen auf höchstem Niveau. Warum diese satirische Oper mit ihrem Wiener Schmäh bislang so selten und in Deutschland noch nie aufgeführt wurde, weiß niemand so genau.
Fest steht nach der Premiere am Samstagabend im Stadttheater: Allen, die statt aufgeblasener Klangkaskaden im atonalen Allerlei lieber ein schmuckes, gut abgestimmtes Stück moderner Kompositionskunst genießen wollen, ist ein Besuch von »Kehraus um Sankt Stephan« im großen Haus anzuraten.
Komponist Ernst Krenek (1900 – 1991) hat das Libretto selbst verfasst. Nicht immer ist das eine gute Idee. Bei Krenek funktioniert der Coup, obschon er allzu gerne reimt. Die Wiener Mundart macht das wieder wett.
Der österreichische Tondichter beherrscht die Kunst der schnellen Abläufe, ohne dabei zu verwirren oder Fragen aufzuwerfen. Die Anschlüsse stimmen. Auf Ouvertüren verzichtet der Komponist in beiden Akten. Stattdessen nutzt er alle ihm zur Verfügung stehenden Stilmittel – vom Gassenhauer über die Spätromantik bis hin zur Zwölftonmusik. Ironie gehört dazu, musikalisch wie textlich.
Bei Schönberg macht Krenek nur kurz Station. Das Ziel des Wieners ist das tonale Geflecht, auch wenn seine Musik oft kleinteilig und freitonal daherkommt. Dirigent Florian Ziemen nennt den Stil in Anlehnung an die Malerei Pointillismus und meint damit das dichte Nebeneinander klanggewordener Miniaturen, die sich zu einem Gesamtbild fügen, ohne dass allzu oft ein Tutti erklingt. Das Philharmonische Orchester Gießen musiziert unter Ziemen mit spürbarer Leichtigkeit. Beschwingt erklingt die anspruchsvolle Partitur. Krenek gönnt dem Hörer trotz Neutonalität die Rückkehr zum Grundton. Er nutzt Kadenzen und Leittöne – das schmeichelt dem Publikum und beruhigt sein Ohr. Kreneks 91-jährige Witwe ließ es sich nicht nehmen, am Samstag der umjubelten Premiere beizuwohnen.
Die verwobene Handlung mit zahlreichen Akteuren im Wien der Jahre 1918 bis 1928, die im Programmheft vier Seiten einnimmt und aus der Mozart drei Opern gestrickt hätte, treibt munter voran. Der Chefausstatter des Hauses, Lukas Noll, hat ein surreales Einheitsbühnenbild auf zwei Ebenen entworfen. Zeitgemäße Kostüme unterstreichen das Geschehen. Gespielt wird in einem goldenen Bilderrahmen, der die Bühne einfasst. Treten die Akteure an die Rampe, fallen sie wortwörtlich aus dem Rahmen.
Eine Wiener Stimme aus dem Off (von Regisseur Hollmann gesprochen) benennt den jeweiligen Spielort. Prospekte verdeutlichen die Szenerie. Drei in schwarze Barockgewänder gekleidete Pompes Funèbres (Personen, die in Wien professionell eine Bestattung begleiten) hat Hollmann dazuerdichtet. Ansonsten beschränkt er sich auf das Nötigste – weniger ist bei ihm mehr. Beispiel: In der kurzen Kirchenszene betritt die heilige Maria mit Puppenbaby im Arm die Bühne und macht klar, wo sich Elisabeth befindet.
Der Anfangs- und Schlussprospekt mit einem großen alten gestutzten Baum steht als Symbol für die Folgen des Krieges. Während des Stücks ist dieses karge Motiv oft auf dem Kopf stehend im Hintergrund zu sehen, weil die Welt tatsächlich kopf steht.
Wolfgang Schwaninger verleiht Rittmeister Brandstetter solide Gestalt. Stimmlich wird er von Wilfried Staber als Winzer Kundrather niedergerungen. Staber singt mit seinem mächtigen Bass alle an die Wand. Sopranistin Naroa Intxausti als Kundrathers Tochter Mitzi intoniert mit feinem Humor und glasklaren Höhen. Heike Susanne Daum als Elisabeth lässt ihren stolzen Sopran elegant und rein erklingen. Tenor Dan Chamandy glänzt als schmieriger Emmerich, Martin Berner als Industrieller Koppreiter. Schauspieler Harald Pfeiffer scheint als gebürtigem Österreicher die Rolle des Oberwachmanns Sachsl auf den Leib geschrieben. Er kann Brandstetters Leiche nicht finden, weil der gar nicht tot ist: »Wo kämen wir denn hin, wenn schon die Leichen keine Disziplin halten?«
Tomas Möwes gibt lauthals den Berliner Kabulke, der mehr ruft als singt. Tenor Erik Biegel vom Staatstheater Wiesbaden ist nicht zu schlagen, wenn er wie hier als Ferdinand seine humorige Ader unter Beweis stellen darf. Das gilt auch für Bassbariton Tomi Wendt als feister Fekete. Wendt mausert sich immer mehr zur Allzweckwaffe des Hauses – wann wird er auch im Schauspiel reüssieren? Alle übrigen Akteure sowie der Chor in der Einstudierung von Jan Hoffmann (der im zweiten Akt einen tuntigen Tangosänger mimt), machen ihre Sache gut.
Dass am Ende der depressive Moralapostel Brandstetter überlebt, während sich der verzweifelte Koppreiter erschießt und Fekete von der Arbeitermasse gelyncht wird, darf nach vielen bunten Einfällen und Wendungen als bierernster Schluss gewertet werden. Fazit: Ein Österreicher inszeniert einen Österreicher – Begeisterung allenthalben. Oder um es mit Krenek und Hollmann zu sagen: Schee woars!
Gießener Allgemeine Zeitung, 17.05.2015, Manfred Merz